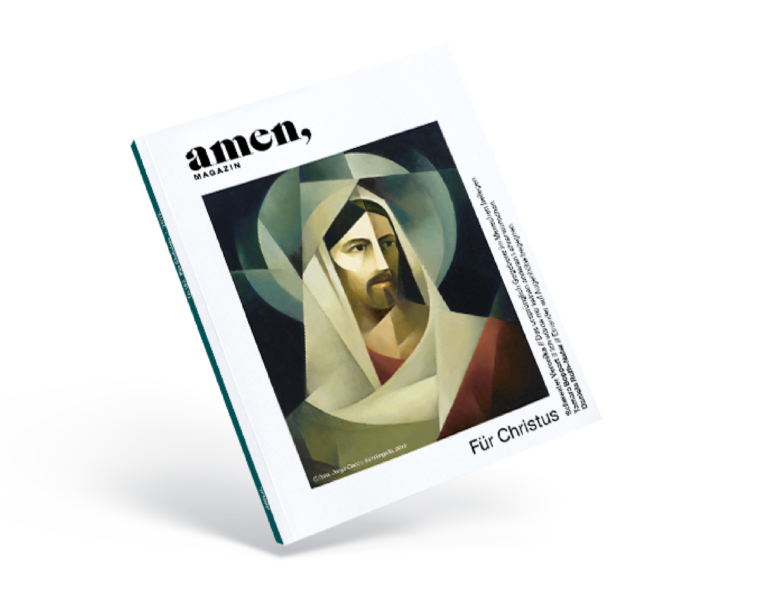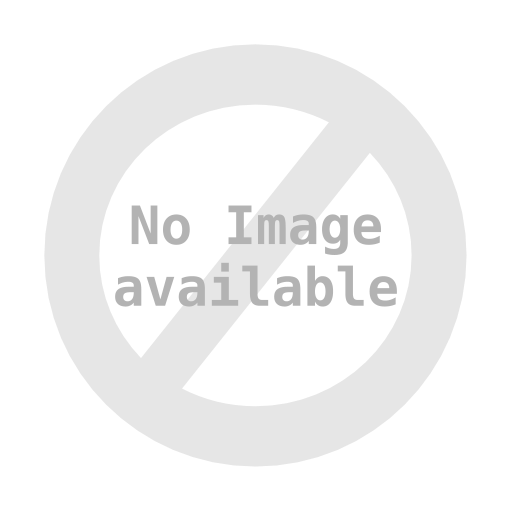Für den ganzen Christus
| von |
Andreas «Boppi» Boppart |
Christus ähnlicher zu werden, ist ein lebenslanger Prozess, der eine ehrliche Selbstreflexion voraussetzt und wohl auch in der Ewigkeit noch nicht abgeschlossen sein wird. Die zentrale Frage, die wir uns als Christinnen und Christen dabei immer wieder stellen sollten, ist: Welchem Jesus folge ich nach?

Wenn ich bei meinem Navi auch nur einen einzigen Buchstaben falsch eingebe, kann ich mein Ziel um Hunderte von Kilometern verfehlen, wenn nicht Tausende. Damit wäre ich nicht der erste. So viele Menschen schiessen aus einem ähnlichen Grund mit ihrem Glauben an der ursprünglichen Idee von Gott vorbei. Mahatma Gandhi, der Kopf der indischen Unabhängigkeitsbewegung, sagte einmal:
«Ich mag euren Christus, aber ich mag eure Christen nicht. Eure Christen sind Christus gar nicht ähnlich.» Damit trifft er leider ins Schwarze, tendieren wir doch allzu oft dazu, einem einseitigen Jesus nachzufolgen. Das, was oft zu voreingenommenen und manchmal auch ungesunden Glaubensauswüchsen führt, sind Reduktionismus und Verkürzungen in unserem Gottes- respektive Jesusbild, derer wir uns nicht bewusst sind. Es ist daher entscheidend für einen gesunden Glauben, dass wir unseren «Zweidrittel-Jesus», wie ich es nenne, ganz werden lassen. Erst dann kann er seine Wirkungskraft ungehindert in diese Welt hinein entfalten.
Der «Zweidrittel-Jesus»
Rund um die Welt haben Menschen ein Bild von Jesus – wobei diese Bilder manchmal einen bestimmten Aspekt von ihm überbetonen und folglich seine wahre Persönlichkeit verzerren. Jesus als ein strenger, humorloser Polizist, der darauf achtet, dass unser Leben innerhalb der Anti-Spass-Markierung verläuft. Oder ein kleiner Che Guevara, der rebellisch die Mächtigen bekämpft und die Gesellschaft umstürzen will. Vielleicht auch ein Gnade-überströmender Pazifist, der überall Blümchen und Peace-Parolen an die Häuser sprayt und jeden in den Himmel liebt. Oder er ist ein süsses Christkind geblieben, das mit leuchtendem Gesicht nach wie vor in der Krippe liegt und nie erwachsen wird. Die einen machen ihn so heilig, dass er ein paar Meter über dem Boden schwebend nichts mehr mit ihrem Alltag zu tun hat – weit entfernt umkreist er ihr Leben wie ein Satellit die Erde. Andere entziehen ihm wie mit einer geistlichen Vakuumpumpe den letzten Hauch Göttlichkeit und haben dann einfach noch den philosophierenden, historisch flachgestrichenen Jesus – wie bei einer ausgedrückten Zahnpasta-Tube. Beides macht ihn für unser persönliches Leben gleichermassen unbedeutend.
Unsere Jesus-Variationen mögen auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch sein. Man hat einfach Vorlieben für bestimmte Eigenschaften von ihm. Es kann sein, dass wir uns in die Zweidrittel von Jesus verliebt haben, die uns von unserer Persönlichkeit und Geschichte her gerade am nächsten liegen. Aber ich bin überzeugt: Man kann den gerechtigkeitsliebenden, konsequenten «Ich peitsch alle aus dem Tempel raus, die diesen entweihen»-Jesus nur verstehen, wenn man den ganzen Jesus sieht. Denjenigen, der in vollendeter Hingabe selbst für die Menschen am Kreuz gestorben ist, die ihn ans Holz genagelt haben. Umgekehrt gilt das natürlich ebenso. Es lohnt sich daher, sich auf die Suche nach dem ganzen Jesus zu machen und sich nicht vorschnell mit dem Zweidrittel-Lieblings-Jesus zu begnügen.
Die «Sanftverdrehung»
Es gehört zum Urproblem der Menschheit, dass wir uns falsche Bilder über Gott basteln, um so «besser» zu leben. Schon die Psalmisten in der Bibel scheinen diese Tendenz zu haben. Wenn einer seiner Sehnsucht Ausdruck verleiht und hoffnungsgequält einen Feinde-zerstörenden Gott besingt, dann geht das wohl mehr in die Kategorie «eigenes Gottesbild» und «Wunschdenken der Seele», als dass es Gott abbildet, wie er sich später in Christus gezeigt hat. Oder spulen wir noch weiter zurück. Bereits bei Adam und Eva kommt die Schlange mit der Frage: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? (1. Moses 3,1). Eine listige und verführerische «Sanftverdrehung» der Wahrheit. So ganz knapp am Ziel vorbei von dem, was Gott tatsächlich gesagt hat. Es klingt nach einem spassverderbenden, limitierenden, zurückstutzenden Gott, wenn man der Aussage der Schlange Glauben schenkt. Und nicht nach dem eigentlichen Gott, der uns mit abertausenden von Bäumen ein Leben im Überfluss zur Verfügung gestellt hat – während er mit nur einem Baum die Möglichkeit marginal klein hält, dass wir uns gegen ihn auflehnen. Das ist ein komplett anderes Narrativ.
Immer wieder schleichen sich in unsere religiösen Systeme und unser eigenes Denken leichte Wahrheitsverschiebungen ein, die zwar ziemlich fromm klingen, am Ende aber das Wesen von Gott bis zur Unkenntlichkeit verzerren und zu falschen Rückschlüssen führen, wie etwa: «In der Welt gibt es Böses, also muss Gott, wenn er existiert, böse sein.» Gott wird dadurch fälschlicherweise immer wieder zur Projektionsfläche. Doch nicht nur er. Die Geschichte zeigt, dass wir solchen Scheinkausalitäten regelmässig auf den Leim kriechen, so geschehen bei der Tomate: Im 16. Jahrhundert wurde das Nachtschattengewächs als «Giftapfel» beschimpft. Entdecker hatten sie aus Mexiko nach Europa gebracht, woraufhin etliche reiche Menschen durch den Verzehr krank wurden oder gar starben. Doch Schuld war nicht die arme Tomate, die dafür hinhalten musste, sondern, wie sich herausstellte, waren es die Zinnteller der adligen Aristokraten. Die Säure der Tomate löste das Blei auf, das zu einem hohen Anteil in den Tellern enthalten war und führte zur Vergiftung – während die Tomate vom Pöbel mit den Holztellern problemlos konsumiert werden konnte.
Genauso wie der Ruf der Tomate aufgrund des bleihaltigen Zinntellers gelitten hat, führen «giftige» Verhaltensmuster und Behauptungen von Christinnen und Christen immer wieder zu Fehlschlüssen auf Gottes Wesen. Deshalb ist Jesus so zentral für unseren Glauben.
Durch Christus blicken
Warum denn überhaupt dieser Fokus auf Christus sein muss, mag man sich berechtigterweise fragen. Die Begründung ist ähnlich kurz wie die Frage selbst: Weil Gott sich in Christus gezeigt hat! Wer mich sieht, sieht den Vater (Johannes 14,9). Gott ist nicht anders als das, was wir in und durch Christus sehen – denn er hat sich entschieden, in seiner ganzen Fülle in Christus zu wohnen (vgl. Kolosser 1,19). So drückt Gottes Wesen und Charakter durch jede Pore des Lebens, des Redens und des Handelns, des Sterbens und des Auferstehens von Jesus durch. Durch Christus, den Lebenden, den Gekreuzigten und den Auferstandenen sehen wir Gott.
Dieses «Gott durch Christus»-Anschauen kann unser Gottesbild heilsam erschüttern, zurechtrücken und zurechtschleifen. Passend dazu die Worte des grossen Schriftstellers und Apologeten C. S. Lewis: «Ich glaube an das Christentum, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist – nicht nur weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann.» Ich würde diese Aussage adaptieren auf Christus als Licht der Welt, der die Dinge erhellt, damit ich sie überhaupt erst sehen kann. Und was ich dabei durchs Kreuz geschaut erblicke, ist eine überzeugend verzahnte Grosserzählung der Weltgeschichte, die mich glauben lässt. Das Bild von einem sehnsüchtig liebenden Gott und einer erlösungsbedürftigen Schöpfung.
Ein anderer grosser Apologet, G. K. Chesterton, bemisst den Wert einer Theorie zur Erklärung der Welt an dem Ausmass an Erhellung, die sie mit sich bringt: «Wir setzen uns eine Theorie auf wie einen Zauberhut und die Geschichte wird durchsichtig wie ein Glashaus.» Das Kreuz und Christus als Zauberhut aufgesetzt malt ein Weltbild, in dem ich das existentiell Böse, das menschlich Böse, die Fähigkeit des Menschen Gutes zu tun sowie das universelle Versöhnungswirken Gottes – all diese widersprüchlichen Dinge – zusammen einbetten kann. Es erklärt mir stimmig, was der Zustand der Welt und derjenige von uns Menschen ist. Es erklärt mir mich selbst. Lässt die Wände der «Sinn des Lebens»-Kiste durchsichtig werden. Lässt diese Kiste überhaupt erst existieren. Und malt mir einen Gott vor Augen, den ich nicht vollends durchschaue, aber der in den Bereichen, in denen ich ihn sehe, so wunderbar schön, so überfliessend liebend ist, dass es mir genügt, um mich ihm hinzugeben und seine Königsherrschaft mit Freude zu bestätigen.
Er ist genug
Und dieser Christus ist tatsächlich genug, das ist keine fromme Floskel. Die Geschichte von Bartimäus malt es deutlich vor Augen. Kurz vor seinem Tod war Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern in Jericho. Als sie die Stadt verlassen wollten, hörte der blinde Bartimäus, wie Jesus in der Nähe vorbeiging. Zweifelsohne hatte er schon viele Geschichten über diesen Jesus gehört, dass er revolutionäre Dinge predigte und Wunder tat. Als er laut nach Jesus schrie, wurde Bartimäus von den Umstehenden harsch zurechtgewiesen, was ihn jedoch nur dazu veranlasste, noch lauter zu werden. Jesus hörte Bartimäus Gebrüll, liess ihn zu sich bringen und fragte ihn, was er wolle. «Rabbuni, dass ich sehend werde», war seine Antwort (Markus 10,51). Und Jesus heilte ihn aufgrund seines Glaubens, woraufhin Bartimäus begann, ihm sogleich nachzufolgen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie überwältigend die Eindrücke für Bartimäus gewesen sein müssen – all die Farben, die Menschen, die Welt. Und dann diesen Jesus vor Augen, von dem er so viel schon gehört hat, so viele unglaubliche Wundertaten. Und nun kann er endlich selbst sehen, kann es selbst erleben, ist aus nächster Nähe mit dabei und muss sich nicht nur alles immer erzählen lassen. Nur, was er nicht weiss: Sein neuer Meister ist bereits am Ende seiner Wirkungszeit angekommen und auf seine letzten Tage vor der Kreuzigung eingebogen. Euphorisiert ist Bartimäus sehr wohl dabei, als sein Meister kurz nach diesem Wunder wie ein König gefeiert und mit Palmblättern bewedelt auf dem Esel in Jerusalem einzieht. Aber das war’s dann auch schon. Bartimäus erlebt keine Speisung von Tausenden, kein «Auf dem Wasser»-Gehen und kein «Wasser in Wein»-Verwandeln. Das Maximum ist gerade noch ein verfluchter Feigenbaum, der keine Früchte mehr trägt. Wohl eher eine mittelmässig ermutigende Einladung zur Nachfolge.
Bartimäus wird sehend und alles, was er sieht, nachdem er wohl ein paar Tage benötigt hat, um überhaupt mit der Flut an neuen Sinneseindrücken klarzukommen, ist Christus am Kreuz. Aber: Genau das reicht. Würde es nicht reichen, hätte Jesus die Augen von Bartimäus schon viel eher heilen müssen. Aber dieser Christus der Gekreuzigte ist genug. Er ist es, auf den wir immer wieder unseren Blick richten dürfen – wir dürfen lernen, durch ihn und das Kreuz alles zu sehen.
Ich fühle mich sehr mit Bartimäus verbunden, denn oft blicke ich nicht durch, bin ich der Blinde, der Nicht-Sehende. Und genau wie Bartimäus bin ich manchmal überfordert von all dem Geschrei, das wir veranstalten, verwirrt von irgendwelchen Palmwedeln, und habe das Gefühl, nur «Esel» vor mir zu sehen. Doch da ist auch er, Christus der Gekreuzigte. Und ihn zu blicken reicht. Denn was Gott in ihm getan hat, hat mich zum Leben befreit. Seine Erlösungskraft durchdringt jede Pore meines Seins, verändert mich von innen heraus. Versöhnt mich. Vergibt mir. Befreit mich. Entschämt mich. Lässt mich atmen. Deshalb bleibe ich unterwegs, dem ganzen Christus hinterher.
 Bild
Bild