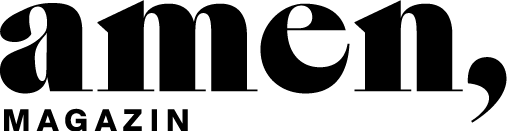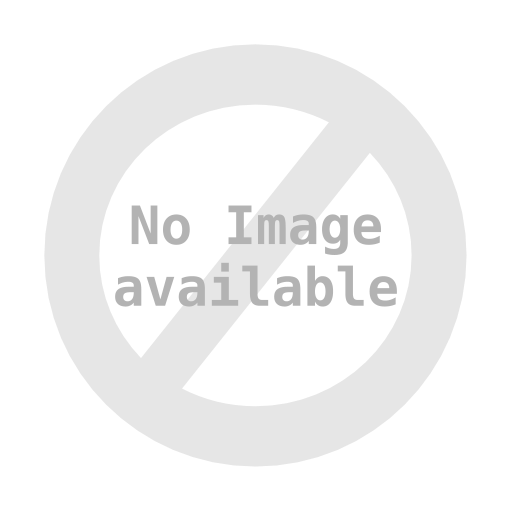Andreas «Boppi» Boppart leitet seit zehn Jahren Campus für Christus Schweiz. An der Organisation begeistert ihn die lebendige Dynamik bei gleichzeitiger Beständigkeit und Bodenhaftung – und dass es dabei immer um Menschen und «für Christus» geht, selbst wenn sich im Laufe der Jahrzehnte im Ausdruck manches verändert hat.
Boppi, du bist 2004 als Mitarbeiter zu Campus für Christus gekommen, 2013 hast du die Leitung übernommen. Was ist das für eine Organisation, die dich offenbar so fasziniert?
Bei Campus begegne ich Menschen, die vorwärts träumen. Die Grundstimmung ist pulsierend, «vibrant», wie man auf Englisch so schön sagt. Da wird auf eine gesunde Art euphorisch und gross geglaubt, und gleichzeitig setzt man die Dinge konkret um. In all den Jahren hatte ich nie das Gefühl, etwas sei für immer gesetzt oder wir wären irgendwo stehen geblieben. Pionierhaft brachen immer wieder neue Dinge auf. Gleichzeitig ist die Organisation sehr stetig. Diese einzigartige Kombination aus Abenteuerlust und Konstanz löst nach wie vor eine grosse Anziehungskraft auf mich aus. Unser Auftrag hat sich über die Jahrzehnte zwar gewandelt und in eine faszinierende Breite entwickelt, aber das für Christus ist dabei immer zentral geblieben. Campus bildet Ministries, die Gottes Liebe abbilden und es Menschen ermöglicht, Christus zu begegnen.
Hast du spezielle Erinnerungen an einzelne Initiativen?
Immer wieder durfte ich erleben, wie die Nähe zur Aktualität und die Beweglichkeit der Organisation eine ihrer Stärken ist. Jüngst haben wir das in Zusammenhang mit der Nothilfe in der Ukraine erlebt. Die Mitarbeitenden von Campus Ukraine baten um Hilfe, da sie Menschen aus den Gefahrenzonen herausholen wollten und Autos dafür benötigten. Innerhalb weniger Tage fuhren wir los und brachten aus der Schweiz kleine Busse, die fortan Menschenleben retteten. Auch als das Erdbeben die Türkei erschütterte, waren wir sofort mit geschultem Personal vor Ort. Mit einem internationalen Team machten wir uns daran, Tiny Houses als Unterkünfte zu errichten. Aber auch der Internetbereich, wo wir mit
«MyStory» oder «Mini Gschicht mit Gott» an den Start gingen und dabei zu Tausenden Christen und ganze Gemeinden darin schulen konnten, wie man den eigenen Glauben formulieren kann. Das sind nur einige Beispiele unter vielen. Wir sind nicht statisch und doch stetig.
Als du vor zehn Jahren Leiter wurdest, hattest du da Vorstellungen, Pläne und Träume für die Zukunft von Campus?
Ich wünschte mir, dass die Bewegung «auf Jesus zu» nicht abreisst – mit Beiträgen unsererseits, aber auch selbstverständlich losgelöst von Campus. Ich träumte auch davon, dass in Europa etwas aufbrechen würde. Als wir THE FOUR starteten, wollten wir das Ministry in hundert Ländern sehen, nicht nur bei uns. Tatsächlich zeigte dieser Arbeitszweig einen unglaublichen multiplikativen Effekt. Bis dato gibt’s THE FOUR als eigenständiges Ministry in 43 Ländern, und via unsere Partner von Global Outreach Day wurden die Flyer und Armbänder rund um den Globus in teils schwindelerregenden Massen eingesetzt. Aber ich habe keine Campus-Bucket-List. In der Entscheidungsfindung lasse ich mich oft von Beziehungen und Herzensimpulsen leiten. Die wirklich erfolgreichen Dinge bei Campus waren oft die ungeplanten, in die wir aufgrund ihrer Notwendigkeit quasi hineingestolpert sind. In der Geschäftsleitung und auch in den Ministryteams machen wir natürlich schon unsere Pläne, aber es sind am Schluss Menschen, die Dinge rund um ihre Persönlichkeit und Leidenschaft herum anschieben. Und im besten Falle Gott, der uns etwas zufallen lässt.
Gab es Überraschungen, unerwartete Wendungen?
Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir Christinnen und Christen immer mal wieder in so grosse Spannungen geraten. Das war und ist eine sehr unangenehme Überraschung, und manchmal denke ich, dass schon viel erreicht ist, wenn wir am Ende unseres Lebens immer noch an Gott glauben – trotz uns Christinnen und Christen.
Als Organisation haben wir auch Initiativen lanciert, die nicht oder noch nicht gegriffen haben, zum Beispiel die Hub-Strategie. Wir wollten an einzelnen Standorten in der Schweiz Bürogemeinschaften gründen, die gleichzeitig auch Begegnungsorte sind, wo das Leben pulsiert und die es Aussenstehenden ermöglichen, ein Stück Weg mit uns als Campus-Community zu gehen. Das verläuft alles sehr schleppend – auch, weil wir von Corona stark ausgebremst worden sind. Wir sind nicht an dem Punkt, an dem wir sein möchten. Solche Situationen brauchen weise Entscheidungen, ein Hinschauen, ob wir etwas falsch machen, ob wir etwas verändern müssen oder ob es einfach nochmals eine Runde Geduld braucht.Das sind herausfordernde Leiterschaftssituationen.
Der Begriff Campus steht für die erste Zielgruppe, welche die Gründer im Blick hatten: die Studierenden, die man mit dem Evangelium erreichen wollte. Weitere Zielgruppen kamen über die Jahre hinzu. Was denkst du, passt dieser Ansatz noch?
Ich glaube, das ist nach wie vor ein guter Ansatz, weil er uns hilft, sowohl spezifisches Material zu entwickeln als auch auf Menschen zuzugehen. Wir wählen ja nicht eine Zielgruppe aus, um andere zu diskriminieren oder auszuschliessen. Vielmehr kommen immer wieder Mitarbeitende zu uns, die einen besonderen Zugang zu einzelnen Gruppen haben, etwa zu Diplomaten oder jüngst mit dem Anliegen, etwas zu unternehmen für
Frauen, die in Menschenhandel geraten. Wir haben in der Schweiz Subkulturen, die wir mit unseren Gemeinden nicht erreichen. Gerade viele der Migrantinnen und Migranten finden keinen Zugang zu einer gutbürgerlichen Schweizer Gemeinde. Da müssen wir in Zukunft unbedingt noch zulegen, Subkulturen identifizieren und Menschen finden, die einen Zugang zu diesen Subkulturen haben. Bei Campus haben wir offene Türen für Mitarbeitende, die hier pionierhaft Projekte starten wollen.
Wie sieht «für Christus» heute bei Campus aus?
Wir sind Teil eines Prozesses, der sich in den vergangenen Jahrzehnten in evangelikalen Bewegungen vollzogen hat und in dem sich verschiedene Ausprägungen im Glaubensvollzug entwickelten. Es geht im Wesentlichen darum, wie der evangelistische und der soziale Zugang zu sehen und zu gewichten sind. Bei Campus Schweiz leben wir diese beiden Aspekte nebeneinander seit den 1990er-Jahren, als wir in Nordkorea unsere Landwirtschaftsprojekte starteten. Wir sehen das ganze Evangelium für die ganze Welt, nichts weniger. Soll heissen, Erlösung beruht nicht nur auf dem Seelenheil des Einzelnen, sondern schliesst die ganze Schöpfung mit ein. Wir haben den Auftrag, das Evangelium ganzheitlich zu leben und zu verkünden. Ansonsten haben wir als Christinnen und Christen keine Glaubwürdigkeit. Mit «dimensionX» (dimension-x.com) haben wir übrigens ein spielerisches und dialogisches Kursmaterial für Kleingruppen erstellt, um der Frage
nachzugehen, was um Himmels willen denn das Gute an der Guten Nachricht ist.
Deine Hoffnungen und Träume für die Zukunft von Campus?
Die geplante EXPLO Ende 2025, mit der wir wieder ins Miteinander rufen, löst Hoffnung in mir aus. Ich träume davon, dass wir Christinnen und Christen konfliktfähiger werden, dass wir grosszügiger verschiedene Meinungen stehen lassen können und trotzdem dem gleichen Christus nachfolgen. Ich wünsche mir, dass wir lernen, Spannungen auszuhalten, statt sie ständig auflösen zu wollen. Der gemeinsame Auftrag als Teilhabende an der «Missio Dei» – Gottes Mission zur Erlösung dieser Welt und der Menschen – ist so gross, dass es schade wäre, wenn wir uns weiterhin nur mit uns selbst beschäftigten.
Wie kann das gelingen?
An den theologischen Fragen kristallisieren sich die Dinge zwar, aber vieles ist auch eine Kulturfrage. Intern bei Campus gestalten wir eine «Generous Orthodoxy»-Kultur: Ich darf meine klare Lehrmeinung haben und muss die auch nicht ändern. Gleichzeitig kann ich in einer Grosszügigkeit andere Überzeugungen stehen lassen, ohne sie damit gutheissen zu müssen. Das ist ein hoher Anspruch, der persönliche Demut erfordert. Wir wollen ein Profil schärfen, bei dem wir Menschen auf Christus hinweisen – die Menschwerdung Gottes, seine Auferstehung und die Möglichkeit einer Hinwendung zu ihm – und daneben eine grosse Weite in den dafür nicht zentral wichtigen Themen leben. Ich glaube, wir müssen lernen, einander zu erkennen und nicht bei der Angst vor dem anderen stehen bleiben. Dazu gehört, dass wir einander zuhören müssen. Als Organisation haben wir diesbezüglich Austauschgefässe geschaffen, in denen wir unter anderem anders denkenden Menschen Raum geben. Das war schon immer Usus bei Campus – vor drei Jahrzehnten etwa mit der ganzen charismatischen Dynamik rund um das Wirken des Heiligen Geistes. Da haben wir als Werk auch «wilde Leute» zu uns eingeladen und ihnen zugehört – nicht naiv, aber unbedarft und lernend. Wir hören hin mit der Frage: «Wo ist Gott da drin in diesen neuen Strömungen?» Im besten Fall sind diese Dinge ja auch Hinweise von Gott, mit denen er uns eine Einseitigkeit oder ein Ungleichgewicht aufzeigt, wo wir gesunden können. Wir müssen das in der Folge ja nicht 1:1 so übernehmen. Als Campus ist uns das immer wieder zum Segen geworden. Und natürlich hat uns geholfen, dass wir mit so vielen Christinnen und Christen weltweit quer durch alle Kulturen und Nationen hindurch unterwegs sind, genauso aber auch durch alle Gemeinden und Kirchen.
Zum Schluss: Was hast du ganz persönlich neu gelernt über Gott in den letzten Monaten?
Neu entdeckt habe ich beispielsweise, dass Mission stark mit «Präsenz» verknüpft ist. Das ist mir beim Studium von Theologen der Südhalbkugel und bei der Bildbetrachtung einer indischen Dalit-Malerin aufgefallen. Oft hat «Neues an Gott entdecken» auch damit zu tun, dass ich an mir und in mir drin etwas Neues entdecke. So hat das Studieren der Missionsgeschichte und der Kreuzestheologie in den letzten Monaten meine eigene Begeisterung für Christus und das Kreuzgeschehen neu entfacht. Nicht in einer reduzierten Form, in der man nur noch Jesus und das Kreuz sieht, sondern so, dass sich mir, durch Christus und das Kreuz blickend, so vieles am christlichen Glauben überhaupt erst erschliesst. Als würde man durch ein Schlüsselloch in eine wunderbare Welt hineinsehen – oder durch einen Schrank nach Narnia gehen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass sich das Leben nicht einfach nur linear, sondern irgendwie spiralförmig zu entwickeln scheint. So gelange ich über all die Jahre immer wieder an den Punkt, an dem ich mich mit all meinem Glauben einfach bei Christus wiederfinde. Früher war das in eine grosse Naivität eingebettet, heute in ein sehr viel komplexeres Glaubens- und Denkkonstrukt. Trotzdem lande ich immer wieder staunend bei Christus, der von sich sagt: «Wer mich sieht, sieht den Vater.» In den Worten des evangelischen Theologen Ralph Kunz wäre das wohl «die höhere Naivität» – ein Ausdruck, der mir sehr gefällt.